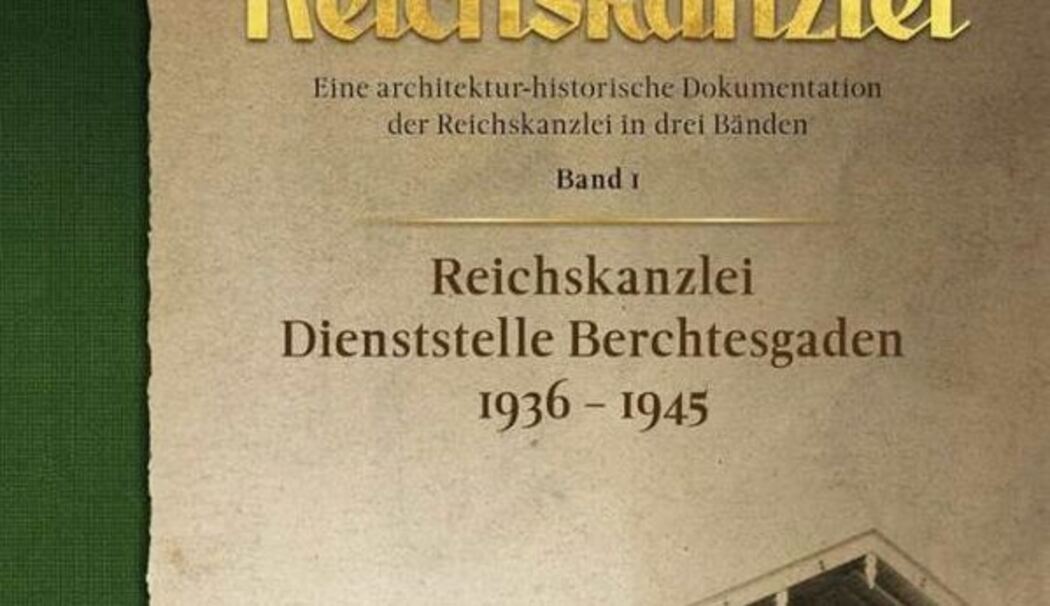Während der Anwesenheit Adolf Hitlers auf dem Obersalzberg musste bis zum Bau der sogenannten »Kleinen Reichskanzlei« in der Stanggaß ein Teil der Berliner Reichskanzlei in Berchtesgaden extern, unter anderem in Pensionen oder im »Diätkurheim Askania«, untergebracht werden. Das war nicht nur umständlich, sondern auch durchaus teuer, wie aus einem Schreiben des Staatssekretärs und Reichskanzlei-Chefs Dr. Hans-Heinrich Lammers hervorging. Darin forderte er zur Begleichung der Unterbringungskosten zusätzliche Haushaltsmittel.
Viele Kandidaten für »Kleine Reichskanzlei«
Etwa zur Jahreswende 1935/1936 entschied sich Hitler dann, in Berchtesgaden eine ständige eigene Dienststelle der Reichskanzlei zu errichten. Im Gespräch waren unter anderem das »Haus Felicitas«, das »Haus Alexandria«, das »Haus Schönfeldspitze«, das »Poistlehen«, die »Villa Schoen« und die »Villa Waldrast«. Architekt Alois Degano aus Gmund am Tegernsee, den Hitler für das Projekt ausgewählt hatte, sprach sich schließlich für die Grundstücke in der Stanggaß aus, die zum Urban-Lehen der Bayerischen Landeskultur-Rentenanstalt und damit dem Bayerischen Staat gehörten. So kam es dann auch. Am 16. September 1936 teilte Lammers von Berchtesgaden aus Degano mit, Hitler habe angeordnet, sofort mit dem Bau zu beginnen. Als Termin der Fertigstellung sei von Hitler der 1. Juli 1937 festgesetzt worden.
Dass Gunther Exner die Geschichte der »Kleinen Reichskanzlei« so detailliert nach erzählen kann, hat er nach eigenen Angaben der Entdeckung vieler neuer und bislang unbekannter Dokumente sowie bis dato nicht veröffentlichter Pläne zu verdanken. Auch viele Fotos, die es in der Öffentlichkeit bislang noch nicht zu sehen gab, hat der Autor in das neue Buch aufgenommen.
Spannender Blick auf die Geschichte
Das Ergebnis der langjährigen Recherchearbeit ist ein durchaus spannendes Werk Berchtesgadener Zeitgeschichte aus den verschiedensten Blickwinkeln. Exner schildert bis ins Detail die Planungs- und Bauarbeiten, die Einrichtung der Gebäude mit Mobiliar, Teppichen und Bildkunst, die Nutzungen der verschiedenen Räume und die Personen, die in der »Kleinen Reichskanzlei« Arbeit fanden. Allen voran Chef Hans-Heinrich Lammers und Ministerialdirektor Paul Franz Ernst Meerwald, »Persönlicher Referent des Reichskanzlers«.
Auch zu den weiteren Grundstückskäufen durch die Nationalsozialisten im Umfeld der »Kleinen Reichskanzlei« hat Gunther Exner recherchiert. So kam er zu der Auffassung, »dass alle Grundstücke der Reichskanzlei, Dienststelle Berchtesgaden ohne Zwang und mindestens zu marktüblichen Preisen erstanden worden sind auch keine Enteignungen wie auf dem Obersalzberg stattgefunden haben«. Das galt dann beispielsweise auch für das »Landhaus Urban«, in das nach dem Ankauf 1941 der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht, Generalfeldmarschall Wilhelm Keitel, einzog. Das zweite, im Nordwesten der Reichskanzlei gelegene Haus wurde »Edda-Häusl« genannt und diente dem Chef des Wehrmachtführungsstabes, Generaloberst Alfred Jodl, als Dienst- und Wohngebäude. In den Kriegsjahren setzten nach den Recherchen Gunther Exners erneut umfangreiche Baumaßnahmen auf dem Gelände der »Kleinen Reichskanzlei« ein. Vor allem für den Luftschutz wurde viel getan, unter anderem durch den Bau eines Luftschutzbunkers. 550 Meter lang und bis zu 40 Meter tief, führte der Bunker hinunter bis zur Bahnstrecke Berchtesgaden-Bad Reichenhall oberhalb der Bischofswieser Ache. Dort ließ Hitler seinen Zug oft halten, um unbemerkt in das Dienstgebäude zu gelangen. Die Rechnung, die die Firma Polensky & Zöllner für die »Schutzraumanlage Reichskanzlei« schließlich ausstellte, belief sich auf 581 737,14 Reichsmark.
Den Zusammenbruch des Dritten Reichs konnte auch die Fertigstellung des Luftschutzbunkers nicht mehr verhindern. Als Luise Jodl am 23. April 1945 ihren Mann, den Generaloberst, in der Stanggaß besuchen wollte, kündigte sich laut Exner das nahende Kriegsende an. Schon am nächsten Tag, dem 24. April, wurde der Reichsminister Lammers auf Hitlers Befehl hin verhaftet, weil er Görings Pläne zur Regierungsübernahme unterstützt hatte. Diese Zusammenhänge konnte Frau Jodl nach Einschätzung Exners aber damals nicht erkennen, da die Ereignisse unter absoluter Geheimhaltung vor sich gingen. Es klingt heute grotesk, wenn man hört, dass Luise Jodl an jedem 24. April noch zum Friseur radelte, wo sie eine wichtige Unterhaltung mitbekam. Sie erfuhr nämlich, dass Hitler in Berlin bleiben und dort sterben wolle. Immerhin vernahm sie wenig später auch, dass ihr Mann die Hauptstadt Berlin am 22. April in Richtung Norden verlassen hatte. Damit war er, das wusste sie, erst einmal in Sicherheit.
Panik bei den Obersalzberg-Gästen
Weniger entspannt war Frau Jodl aber am nächsten Tag, als die britische Luftwaffe den Obersalzberg bombardierte. »Früh am nächsten Morgen dröhnte die Luft von einem Anflugsturm feindlicher Bomber und bald erschütterten schwerste Detonationen vom Obersalzberg her die Luft«, wird sie später aussagen. Und weiter: »Während Frau Keitel gleichmütig den Anflug einer neuen Welle beobachtete, rannte ich, der Berliner Eindrücke gedenkend, hinunter in den Luftschutzkeller«. Luise Jodl ist in den letzten Kriegstagen in der Berchtesgadener Reichskanzlei insbesondere die unheimliche Stimmung, die Auflösungsstimmung, in Erinnerung geblieben. So war eine der letzten Handlungen der Reichskanzlei-Bediensteten die Verbrennung von Akten am 4. Mai 1945. Hildegard Rode, die Sekretärin von Lammers' Staatssekretär Kritzinger, gab hierzu während einer Vernehmung am 24. März 1947 Auskunft. Überhaupt geben die von Exner geschilderten Vernehmungen, auch während der Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse, höchst spannend Aufschluss über die vorausgegangenen Ereignisse in der »Kleinen Reichskanzlei«.
Amerikaner übernehmen »Kleine Reichskanzlei«
Auch weil die Royal Airforce die »Kleine Reichskanzlei« bei ihrem Luftangriff verschonte, konnte die US-Army die Dienststelle nach Kriegsende besetzen. Sie wurde zum Hauptquartier der 101. Airbornedivision. Die Amerikaner verhörten in Bischofswiesen nicht nur Luise Jodl, sondern auch Hitlers Halbschwester Paula, von der Gunther Exner sogar eines der wenigen vorhandenen Fotos aufgetrieben hat.
Als das Gelände später nach dem Abzug der Amerikaner unter die Verwaltung der Bundesrepublik Deutschland kam, ging das Ringen um den Denkmalschutz los. Gunther Exner schildert die jahrelangen Diskussionen, die sich auch in der damaligen Berichterstattung des »Berchtesgadener Anzeigers« widerspiegelten. Letztendlich setzten sich die Denkmalschutz-Befürworter durch, wenngleich viele noch lieber eine museale Nutzung gesehen hätten.
Wohnraum im historischen Gebäude
Dass das Gelände schließlich an den Bischofswieser Unternehmer Johann Hölzl verkauft wurde, der darin Wohnungen schuf, sorgte erneut für Gesprächsstoff. So mancher befürchtete, dass dem Denkmalschutz nicht ausreichend Rechnung getragen werde. Auch Autor Gunther Exner stellte von Zeit zu Zeit bauwerkliche Eingriffe, vor allem am ehemaligen Garagengebäude, fest, die er nicht mit den Denkmalschutz für vereinbar hält.
Mehrmals hatte Exner den neuen Eigentümer damals kritisiert, am Ende aber zeigt sich der Autor doch versöhnlich. So stellt er am Ende des Buches fest, dass »der neue Besitzer des Gebäudes viele Bereiche kosten- und arbeitsintensiv restaurieren ließ und somit das Hauptgebäude doch in mancherlei Hinsicht wieder einem außerordentlich guten Zustand entspricht«.
»Die Reichskanzlei – Eine architektur-historische Dokumentation der Reichskanzlei in drei Bänden«, zahlreiche Abbildungen, Dokumente, Grundrisse, Fotos; Nation & Wissen Verlag, 34,80 Euro.
Ulli Kastner