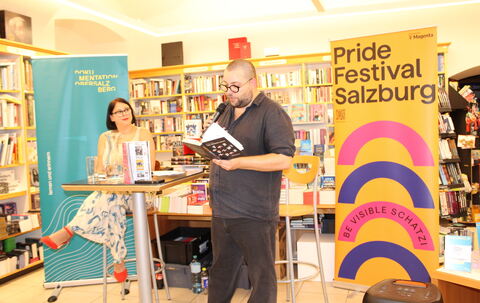Spuren dieser Entwicklung finden sich zuhauf in der Kernzone des Nationalparks Berchtesgaden. Schon vor einiger Zeit wurde das »Almprojekt« gestartet, das diesen historischen Geschehnissen nachgeht. Es gehört zu den Aufgaben des Nationalparks, derartige von Menschen beeinflusste Entwicklungen zu beobachten und zu dokumentieren.
Genauere Untersuchungen gibt es zum Beispiel schon zu den Funtenseealmen. Erstmals urkundlich erwähnt wurden sie 1386 als Teil der Fürstpropstei Berchtesgaden. Allerdings gab es auch eine kurze Zugehörigkeit zum Herzogtum Salzburg; eine Karte aus dem Jahr 1817 belegt den bayerisch-salzburgischen Grenzverlauf mitten durch den Funtensee. Sechs Kaser sind hier dokumentiert.
Auch an dieser Stelle ist der Rückgang der Almwirtschaft zu beobachten. Um 1830 waren noch neun Bauern berechtigt, die Funtenseealmen zu bewirtschaften, 100 Jahre später waren es nur noch fünf und in den 1960er Jahren wurde die Almwirtschaft am Funtensee komplett aufgegeben.
Genau solche Entwicklungen will das Almprojekt flächendeckend erfassen und untersuchen. Der Ansatz ist vielschichtig: Es geht um die Auswirkungen auf die Vegetation, welche Bauern ihre Tiere von wo nach getrieben haben, welche Almen aufgelassen und mit der Zeit verfallen oder verschwunden sind und natürlich auch am Ende um eine möglichst umfassende Darstellung der Veränderungen.
Untersucht wird hauptsächlich der Zeitraum von 1850 bis in die 1960er Jahre, also bevor der Nationalpark Berchtesgaden gegründet wurde. Aufgerufen zur Mithilfe sind nun auch die Leser des »Berchtesgadener Anzeigers«: Denn das Projektteam des Nationalparks mit Hans Maltan, Fritz Eberlein und Doris Huber hofft noch auf viele Schätze aus vergangenen Tagen, Bild- und Filmmaterial in jeder Form. Nachdem die Fotografie zur damaligen Zeit noch sehr neu war, werden gerne auch Karten und Zeichnungen angenommen, die Aufschlussreiches zum Projektziel zum Inhalt haben.
Interessant sind Hinweise auf Almen im ganzen Gebiet des Talkessels, beziehungsweise der ehemaligen Fürstpropstei. So hat das Nationalpark-Team schon einiges bekommen, unter anderem ganze Fotoalben aus Nachlässen oder Dachbodenfunde. Jeder Einreicher wird mit seinen relevanten Dokumenten im Forschungsbericht genannt und erhält nach Abschluss des Projekts einen Forschungsbericht in gedruckter Form.
Angenommen werden alle möglichen Dokumente, analog oder digital, dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten: Persönliche Abgabe im »Haus der Berge« zu den Öffnungszeiten (täglich 9 bis 17 Uhr), eine Einsendung per E-Mail an hans.maltan@npv-bgd.bayern.de oder auch via Whatsapp an die Handynummer 0160-7430665. Bis 15. September läuft dieser Aktionszeitraum nun vorerst, dann wird Zwischenbilanz zu den Einsendungen gezogen.
Hans Maltan, der sich mit dem Thema Almen schon seit über 15 Jahren beschäftigt, hofft auf rege Beteiligung der »Anzeiger«-Leser. Und er freut sich nicht nur über Bildmaterial, sondern »unbedingt« auch auf altes Wissen und Geschichten: »Uns geht es um die Natur und die Menschen.«
Thomas Jander