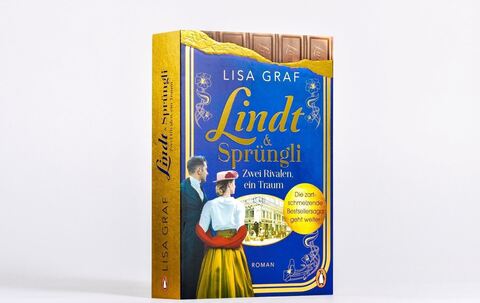Die Verehrung des heiligsten Herzens Jesu ist eine spezielle Ausdrucksform römisch-katholischer Spiritualität, die seit dem frühen Mittelalter als frommes Zeichen der Liebe, der Hingabe und des Dankens nachzuweisen ist.
In der Stiftskirche gibt es so ein Zeichen. Dieses eindrucksvolle und wohl einmalige gotische Herz ist gar nicht so leicht zu entdecken. Selbst eifrige Gottesdienstbesucher brauchten ihre Zeit, um es rechts neben dem Hochaltar bewundern zu können. Es befindet sich in gut 17 Metern Höhe im südlichen Apsisfenster des frühgotischen, um 1300 errichteten Hochchores und es ist der erste gotische Bau im Salzburger Raum. Deshalb fehlen dazu Vergleiche in der Bauplastik.
Dafür ist der Bauherr Propst Johann I. Sax von Saxenau (auch Johannes Sachs zu Sachsenau), reg. 1286/89 bis 1302, danach Bischof von Brixen, verstorben am 23. April 1306, bekannt. Genealogische Forschungen sind nicht eindeutig (Salzburger Bürgergeschlecht); aber man weiß, dass er aus einem auch in der Oberpfalz reich begüterten Geschlecht stammte, eine für ein so gewaltiges Bauvorhaben wichtige Voraussetzung. Die Einkünfte aus dem Salzabbau und die intensiven Salzausfuhren hoben das Berchtesgadener Chorherrenstift wirtschaftlich weit über den Durchschnitt der übrigen Klöster heraus. Dieser gewachsene Wohlstand erlaubte es Propst Johann I., das romanische Münster St. Peter und Johannes der Täufer um einen beeindruckenden wie richtungsweisenden Hochchor mit eingezogener Apsis zu erweitern. Ein Ausdruck der Liebe und Hingabe an einen gütigen Gott.
Es lassen sich noch weitere Gründe für den Bauauftrag aufzählen. Der deutsche König Adolf von Nassau hatte 1294 dem Stift die hohe Blutgerichtsbarkeit (Blutbann) verliehen. Damit war der Augustinerpropst den Reichsfürsten gleichgestellt und zusätzlich gewährte der König dem geistlichen Herrn ein weiteres äußeres Ehrenzeichen, das Recht, einen Bischofsstuhl zu benutzen (sedes pontificalis). Aus Archivalien lässt sich auch auf die Herzensgüte dieses Propstes schließen, da er seinem Stiftskapitel wie der »Landschaft« großzügige Stiftungen vermachte.
An der linken Seite des Chorbogens findet sich in Marmor gemeißelt ein Kopf mit Mitra, wohl ein gelungenes Porträt des Propstes der Bauzeit Johann I. Sax.

Um diesen Hochchor zu erbauen, bedarf es einer Bauhütte mit tüchtigen Bauleuten und eines ebensolchen Baumeisters. Diese Bauhütte war nicht einheimisch besetzt, sondern verweist auf Zisterziensereinflüsse, die hier die Gotik von Frankreich einführten. Die Steinmetze zogen nicht nur die Spitzbögen, sondern auch die schlanken, himmelwärts strebenden Chorfenster hoch. In filigraner Steinmetzarbeit schufen sie durch den Vorgang der Skelettierung des Steins mehrbahnige Maßwerkfenster mit geometrischen Formen. In der Stiftskirche sind es vor allem drei- bis fünfblättrige Fensterrosen und eben einmalig das außergewöhnliche gotische Herz. Die Köpfe in den Konsolen der Bündelpfeiler stellen wahrscheinlich die Steinmetze der einstigen Bauhütte vor. Darf der heutige Betrachter dabei nicht an eine »Verewigung« der Arbeiterschaft denken? Fehlt noch der mögliche Chef der Bauhütte. An der östlichen Konsole direkt gegenüber dem Herzfenster findet man einen fein gearbeiteten »Lockenkopf«. Das kann der namentlich unbekannte Baumeister sein. Es darf ausgeschlossen werden, dass er vom Valentinstag mit seiner Herzsymbolik wusste. Sicher kannte er das Wort des hl. Augustinus »Unruhig ist unser Herz, bis es ruht in Gott«. Das gotische Herz in der Stiftskirche ist sicher mehr als nur ein Symbol zum Valentinstag.
Johannes Schöbinger